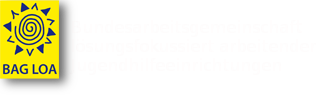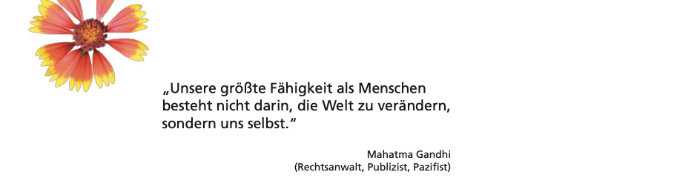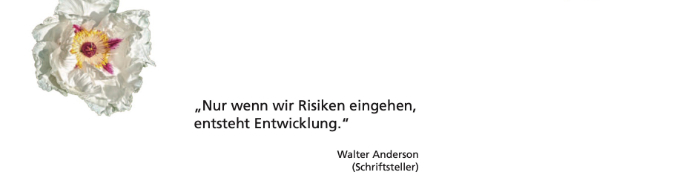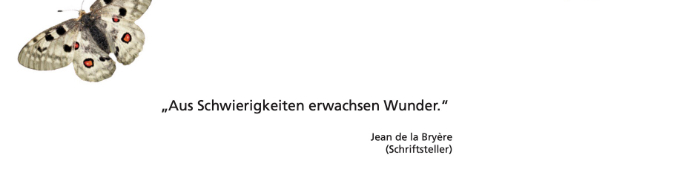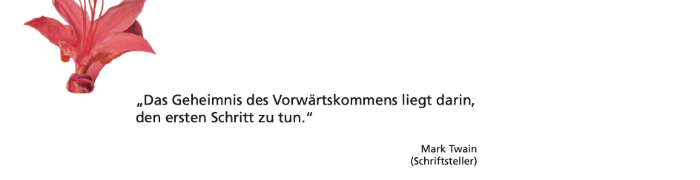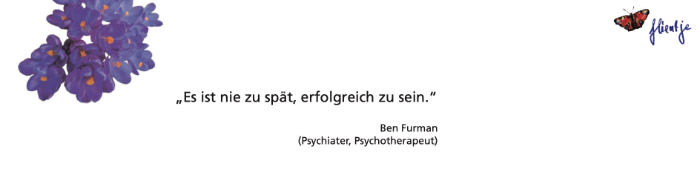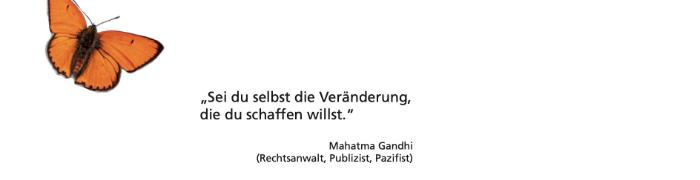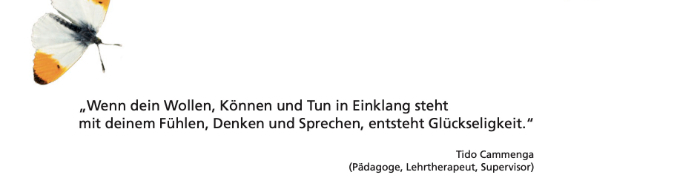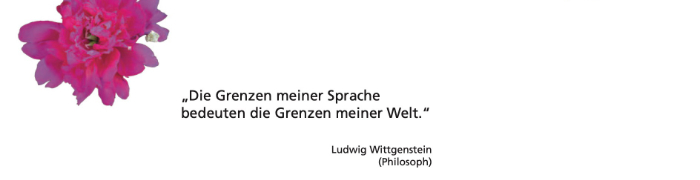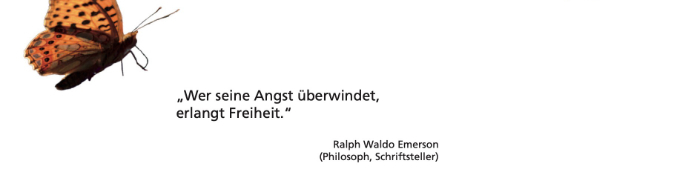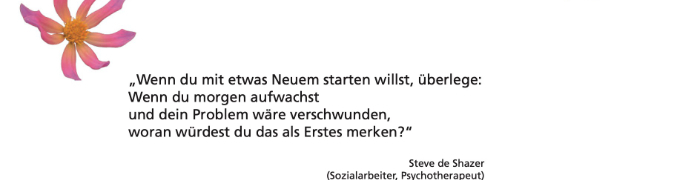Suchen
Impressum
Fachkonzept
Der lösungsfokussierte Ansatz
Steve de Shazer und seine Frau Insoo Kim Berg sind im 1978 gegründeten Brief Family Therapy Center (Kurzzeit-Familien-Therapie-Zentrum) in Milwaukee, Wisconsin (USA), durch viele Therapiegespräche zu dem Ansatz des lösungsfokussierten Modells gekommen.
Inspiriert und angeregt von Milton Erickson, Ludwig Wittgenstein und durch die Gruppe des MRI von Paolo Alto (Bateson, Fisch, Watzlawick, Weakland u.a.) lehrt uns das lösungsfokussierte Modell (solution focused brief therapie), wie Lösungen entstehen, die vom Klienten selbst entwickelt werden und nicht von den Moderatoren (Beratern, Teamern, Prozessgestaltern).
Nach Wittgenstein ist die Beschäftigung mit Problemen ein Ansatz, der vielleicht dazu beiträgt, diese besser zu verstehen, aber Lösungen bestehen nicht zwingend aus denselben Bestandteilen wie die Probleme. „Der Lösung ist es egal, woher das Problem kommt" (bekanntes Zitat von Wittgenstein). Steve de Shazer kam zu der Schlussfolgerung, dass das Reden über Probleme eher das Problem aufrechterhält, ja sogar neue Probleme erschaffen kann. Folgerichtig ist das Reden über Lösungen und Ressourcen eher dazu geeignet, Lösungen zu kreieren. „Problem talk createsproblems. Solutions talk creates solutions" (bekanntes Zitat von de Shazer).
In der Konsequenz dieses Denkens definieren lösungsfokussiert Arbeitende sich selbst als Experten für Prozessgestaltungen im Lösungsraum (auch Prozessgestalter genannt) und unser Gegenüber als Experten für sich selbst.
Das lösungsfokussierte Denken und sein Menschenbild sind u.a. aus dem Konstruktivismus heraus entstanden. Die Konstruktivisten sind zur Überzeugung gekommen, dass es keine absolute Wahrheit gibt, sondern dass jeder Mensch seine eigene Wahrheit hat und dass jeder seine eigene Wirklichkeit konstruiert. Wir konstruieren die Welt durch unsere Vorerfahrungen, unser Denken, durch unsere Sprache und durch unser Handeln.
Dazu sagt der Philosoph Wittgenstein:
„Die gesamte Wirklichkeit ist die Welt.“ (2.063)
„Das Bild (unser eigenes) ist ein Modell der Wirklichkeit.“ (2.12)
„Das (bzw. unser) Bild bildet die Wirklichkeit ab, indem es eine Möglichkeit des Bestehens und Nicht-
bestehens darstellt.“ (2.201)
„In der Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung des Sinnes mit der Wirklichkeit besteht die
Wahrheit oder Falschheit.“ (2.222)
„Ein a priori wahres Bild gibt es nicht.“ (2.225)
„Das logische Bild von Tatsachen ist der (bzw. mein) Gedanke.“ (3)
„Ein Satz ist ein Bild der (bzw. meiner) Wirklichkeit“. (4.01)
(aus: Wittgenstein, Ludwig (2022): Tractus Logico-Philosophicus. Ditzingen: Reclams Unniversal-Bibliothek Nr. 14245)
Eine weitere Grundlage ist die Systemtheorie, hier insbesondere die Kybernetik 2. Ordnung (Dekonstruktion von bestehenden Sinneskonfigurationen). Systemiker sind zu der Erkenntnis gelangt, dass sie in der Arbeit mit unserem Gegenüber Prozesse immer interaktiv beobachten, also Teil eines Arbeitsprozesses werden und über unterstützende Fragen versuchen können, hilfreich zu sein. Systemisch denkende Menschen wissen dabei nicht, was eine Aussage des Gegenübers „tatsächlich" bedeutet und was „objektiv" ein guter Weg für die Beteiligten sein mag. Durch erkundende Fragen nach dem Motto „nachfragen statt wissen“ (neugierig, interessiert) können Menschen befähigt werden, sich eigene Themen anders genug zu erschließen. Als Prozessbegleiter hat der Berater, Pädagoge, Leiter etc. bereits durch seine Anwesenheit und die Art zu beobachten und zu fragen (beispielsweise in den Lösungsraum hinein) die Chance ein System zu erweitern. Er sieht seine Aufgabe darin, eigenes Handeln zu reflektieren und zu hinterfragen mit der Idee unserem Gegenüber Anregungen zu inneren Suchprozessen, Perspektiverweiterungen, alternative Anschlüssen zu eigenen Erzählungen und dasGeschenk von Wahlmöglichkeiten zu ermöglichen. Dabei achtet er verbindlich dieAutonomie und Selbstbestimmung des Gegenübers und sieht Menschen stets als Expert:innen für sich selbst. Das beinhaltet auch die Idee, dass jeder Mensch Lösungen, wie auch (vermeintlich) gute Gründe zum Handeln in sich trägt.
(vgl. www.dgsf.org (2025): Was heißt systemisch?)
Steve de Shazer, Insoo Kim Berg und ihr Team leiteten aus Ihren Erkenntnissen 8 Lehrsätze ab:
(aus: Steve de Shazer, Yvonne Dolan (2022): Mehr als ein Wunder.Heidelberg: Carl Auer.
Auf diesen Leitsätzen fußen eine ganze Reihe an Annahmen, die an unterschiedlichen Orten entwickelt, weiterentwickelt und gelehrt wurden und werden. Annahmen sind dabei Ansichten, die wir für unsere Arbeit als hilfreich erachten (vgl.: Cammenga, Tido: Annahmen für eine wirksame Begleitung und Führung vor dir selbst und den Menschen in deinem Umfeld. Flientje-Heftreihe (Heft 3), Aurich: Familientherapeutische Einrichtung flientje.